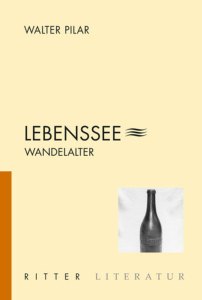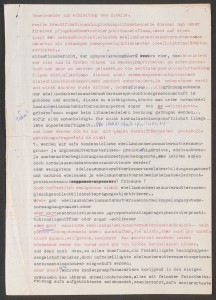Eine Freundin machte mich kürzlich auf einen Artikel im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung aufmerksam, der sie ob der Plumpheit der Argumentation erschreckt und den sie in diesem »Qualitätsmedium« nicht erwartet hatte: Wir schreiben Ende Juli, das Sommerloch wird auch in den Feuilletons mit allerlei unnötigen Texten zum Anschlag von Nizza und – kurz darauf – den Amokläufen in Bayern geflutet. Bereits die Überschrift des Artikels von Willi Winkler ist an Dummdreistigkeit kaum zu überbieten: »Wie die Literatur den Terror erfand«.
»Erfunden« hat »den Terror« bekanntlich weder die Literatur noch irgendein Literat. Das ficht Winkler aber nicht an. Ihm genügt ein allbekanntes Zitat von André Breton für seine krude These:
(…) mit seinem »Zweiten surrealistischen Manifest« stellte Breton 1930 nicht nur der französischen Avantgarde einen Freibrief aus: »Die einfachste surrealistische Handlung besteht darin, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu gehen und blindlings so viel wie möglich in die Menge zu schießen.« Es hat funktioniert.
Was soll da »funktioniert« haben? Tatsächlich läßt sich Winklers Kommentar nur so lesen, als habe Breton zu Gewaltakten wie dem von Nizza aufrufen wollen und als hätte er sich gefreut und bestätigt gefühlt, wenn er die Anschläge von Paris und Nizza noch erleben hätte dürfen. Niemand wird das für eine diskussionswürdige These halten – außer Willi Winkler: Er entblödet sich nicht einmal, von einer »Lizenz zum Töten« zu sprechen – erteilt von André Breton! Zwar räumt er ein, daß der IS sich »kaum« (vielleicht ja doch?) auf den Franzosen berufen werde, aber:
(…) wie Breton verspricht sich der Terrorist einzig von der Gewalt das gewünschte Ergebnis, nämlich maßloses Aufsehen, Furcht und Schrecken, den reinen Terror.
Für den Literaturkritiker macht es also keinen Unterschied, ob jemand Dutzende Menschen tatsächlich um ihr Leben bringt oder ob ein terroristischer Akt in einem literarischen Text, und sei es einem Manifest, imaginiert wird. Zwar verfaßte Breton später auch noch ein Manifest »Für eine unabhängige revolutionäre Kunst« und trat gegen den Algerienkrieg auf. Von Gewaltverbrechen, für die man ihn verantwortlich machen würde, ist allerdings nichts bekannt geworden. Aber selbst wenn man – anders als Winkler – dazu in der Lage ist, fiktionale Texte von Tatsachen-Behauptungen zu unterscheiden: Nie und nimmer gibt es direkte kausale Verbindungen zwischen Verbrechen, die in Fiktionen imaginiert werden, und realen Straftaten. Nach jedem Amoklauf müssen Fachleute auf die diesbezüglichen aufgeregten Journalistenfragen geduldig erklären, daß es keine Beweise dafür gibt, daß Amokläufer durch den Konsum von gewaltverherrlichenden Computerspielen herangezüchtet würden.
Nähme man Willi Winkler ernst, man müßte sich auch Sorgen machen ob des nicht endenwollenden Booms an Kriminalliteratur. Der SZ-Feuilletonist, der Breton genauso wenig verstanden hat wie Dostojewskij, scheint sich diese Sorgen tatsächlich zu machen und schreibt:
Die Literatur, die Kunst insgesamt, schwärmt seit Fjodor Dostojewski für den Mörder, der damit zum modernen Heiligen erhoben wird.
Natürlich »schwärmt« Dostojewskij nicht für »den Mörder«. In seinen Romanen werden anhand exemplarischer Figuren moralische und ideologische Fragen sowie Handlungsoptionen diskutiert und problematisiert. Aber selbst die ganzen Trivial-Autoren, die den Buchmarkt mit ihren Krimis überschwemmen, würde man nicht mal dann ernsthaft dafür verantwortlich machen, sollte die Mordrate irgendwo steigen, wo ihre Bücher sich gut verkaufen. Angesichts von Literaturkritikern wie Willi Winkler erscheint der Niedergang der Printmedien und ihrer Feuilletons nicht als Drohung, sondern als Hoffnungsschimmer.